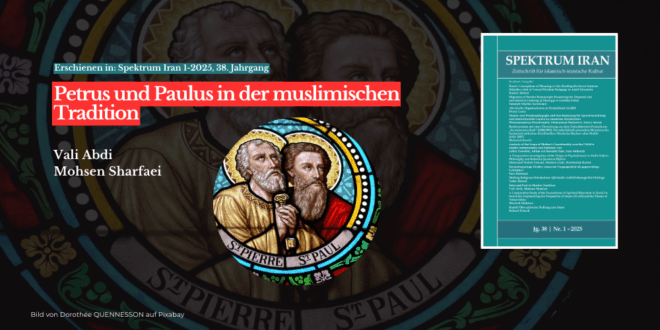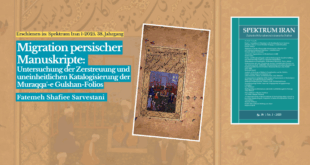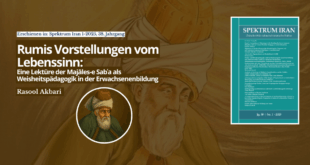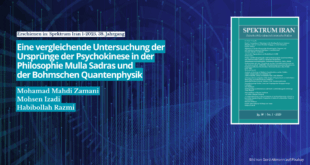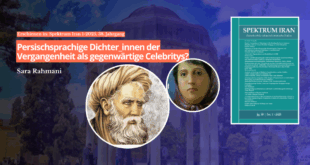Autoren: Vali Abdi, Mohsen Sharfaei
Sobald Muslime Kenntnisse über das Christentum erlangten, begannen sie, über dessen Lehren, Glaubensinhalte und religiöse Rituale zu schreiben und nachzudenken. Darüber hinaus setzten sich Muslime intensiv mit Jesus Christus, seinen Jüngern und Aposteln auseinander. Es scheint, dass muslimische Autoren ihr Wissen über das Christentum zunächst aus dem Koran und mündlichen Überlieferungen bezogen. Ab dem 9. Jahrhundert jedoch erhielten sie Zugang zu authentischen christlichen Quellen, darunter das Neue Testament. In diesen Jahrhunderten beteiligten sich sowohl Christen als auch Muslime an kontroversen und teilweise dialogischen Debatten. Solche direkten Kontakte förderten und vertieften das gegenseitige Verständnis. Die vorliegende Forschung konzentriert sich auf die muslimische Perspektive auf St. Petrus und St. Paulus – ersterer gilt als bevorzugter Jünger Jesu, letzterer als bekehrter Apostel. Wie in den folgenden Seiten gezeigt wird, kombinierten muslimische Autoren koranische und mündliche Sichtweisen mit einigen authentischen christlichen Quellen. Daher erscheint ihr Wissen über diese beiden Apostel mitunter widersprüchlich und inkonsequent. Muslime – insbesondere Schiiten – betrachteten St. Petrus als den wahren und legitimen Nachfolger Jesu. Dennoch verurteilten sie St. Paulus als jemanden, der die wahren Lehren Jesu Christi verfälscht habe.
Erschienen in: Spektrum Iran 1-2025, 38. Jahrgang
Vali Abdi: Assistenzprofessor in der Abteilung für Vergleichende Religionswissenschaft und Mystik an der Ferdowsi-Universität Mashhad, Iran
Mohsen Sharfaei: Wissenschaftler in der Abteilung für Religionswissenschaft der Forschungsstiftung von Astan Quds Razavi in Maschhad, Iran
https://doi.org/10.22034/spektrum.2025.516395.1028
https://www.spektrumiran.com/article_223359.html
 IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland