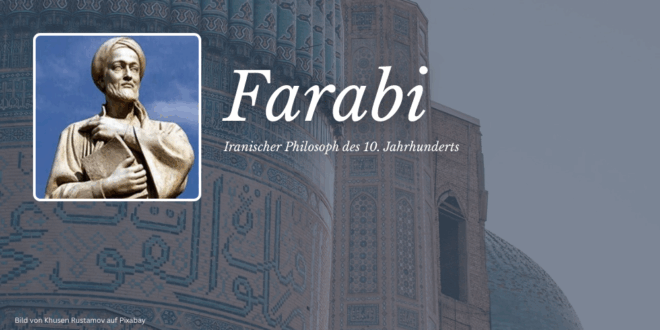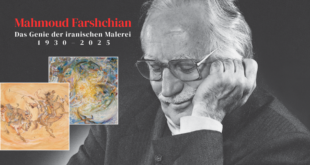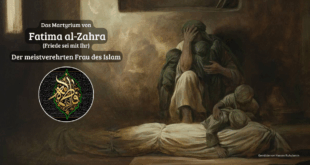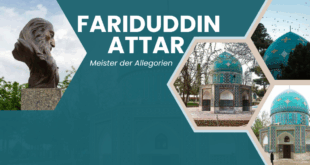Abu Nasr Al-Farabi, bekannt als „Der Zweite Lehrer“ nach Aristoteles, war ein bedeutender iranischer Philosoph. Seine Arbeiten zur Logik, den Naturwissenschaften und dem politischen Denken prägten die intellektuelle Landschaft der islamischen Welt maßgeblich.
Er gehört mit zu den herausragenden und umfassenden Denkern des 10. Jahrhunderts und gilt als größter Theoretiker der arabisch-persischen Musikgeschichte. Es war auch sein Verdienst, dass die griechische Philosophie ihren Weg in das Morgenland fand.
In den Annalen der islamischen Geistesgeschichte gibt es nur wenige Persönlichkeiten, deren Vermächtnis so grundlegend und beständig ist wie das von Abu Nasr Al-Farabi.
Er stammt aus der Provinz Chorasan und wurde im Dorf Wasij, unweit der bedeutenden Stadt Farab, geboren.
Aus diesem urbanen Zentrum leitete er seinen berühmten Namen ab, einen Namen, der zum Sinnbild philosophischen Genies werden sollte.
Al-Farabi, dem Ehrentitel wie „Der zweite Lehrer“, „Der Begründer der islamischen Philosophie“ und „Der Übermittler der griechischen formalen Logik“ verliehen wurden, wird von Historikern und Kommentatoren häufig als der herausragendste Philosoph der islamischen Tradition angesehen.
Al-Farabis beruflicher Werdegang begann mit einer Tätigkeit im Justizwesen. Seine tiefe Neigung zu philosophischen Fragestellungen und metaphysischen Betrachtungen veranlasste ihn jedoch zu einem drastischen Richtungswechsel.
Im Alter von vierzig Jahren gab er seinen Posten auf und begab sich auf eine Reise nach Bagdad, dem pulsierenden intellektuellen Zentrum jener Zeit.
Dort vertiefte er sich unter der Anleitung bedeutender Gelehrter in das Studium der Logik und Philosophie und entwickelte eine besondere Faszination für das aristotelische Werk.
Diese tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Werken des Aristoteles festigte seinen Ruf als „Zweiter Lehrer“, als direkter Nachfolger des „Ersten Lehrers“, Aristoteles selbst.
Trotz eines oft von Askese geprägten Lebens ließ Al-Farabis wissenschaftlicher Eifer nie nach; er erweiterte eifrig sein Fachwissen auf eine Reihe von Disziplinen, darunter Mathematik, Theologie, Alchemie, Militärstrategie, Musik und Medizin.
Den Grundstein für Al-Farabis Werk legt sein umfangreiches Schaffen im Bereich Philosophie und Logik, das vor allem ausführliche Kommentare zu Platon und Aristoteles umfasst.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Die Meinungen der Bewohner der tugendhaften Stadt“, eine visionäre Abhandlung über politische Philosophie; „Risala fi’l-Aql“ („Abhandlung über den Intellekt“), eine tiefgründige Analyse des Intellekts; und „Tahsil al-Sa’ada“ („Das Erreichen des Glücks“), das den Weg zum menschlichen Gedeihen aufzeigt.
Er verfasste Texte in nahezu allen wissenschaftlichen Bereichen außer der Medizin und schuf in der Mathematik und Musikwissenschaft maßgebliche Nachschlagewerke, die bis heute Einfluss haben.
Im Gegensatz zu früheren Kommentatoren strebte Al-Farabi nicht nur nach Erklärungen, sondern auch nach einer Synthese.
In seinem bahnbrechenden Werk „Al-Jam` bayn Ra’yay al-Hakimayn“ („Die Harmonisierung der Meinungen der beiden Weisen“) bemühte er sich, die philosophischen Systeme Platons und Aristoteles zu versöhnen, indem er eine zugrunde liegende Gemeinsamkeit und eine gemeinsame, göttliche Inspiration für ihre Kernkonzepte behauptete.
Darüber hinaus stellt sein ehrgeiziges Werk „Ihsa‘ al-Ulum“ („Die Aufzählung der Wissenschaften“) eine systematische Katalogisierung des gesamten zeitgenössischen Wissens dar, wodurch er wohl als erster muslimischer Gelehrter gilt, der die Idee einer umfassenden Enzyklopädie hatte.
Im Bereich der Logik waren seine Beiträge besonders bahnbrechend. Er beherrschte das gesamte aristotelische Logiksystem und verfasste detaillierte Kommentare zum vollständigen „Organon“. Sein Ansatz war nicht passives Rezipieren, sondern aktives Erneuern.
Al-Farabi werden bahnbrechende konzeptionelle Erkenntnisse zugeschrieben, wie etwa die Kategorisierung der Wissenschaft in „Konzeptualisierung“ (Tasawwur) und „Zustimmung“ (Tasdiq) sowie die Einführung der kritischen Dichotomie von „notwendiger“ (Wājib) versus „möglicher“ (Mumkin) Existenz.
Diese Neuerungen schufen einen erneuerten und dauerhaften Rahmen für die aristotelische Logik. Seine unermüdlichen Bemühungen ebneten nachfolgenden Gelehrten wie Avicenna und Nasir al-Din al-Tusi den Weg, die Logik als Wissenschaft zu ihrer ausgereiften Form weiterzuentwickeln.
Die Nachwirkungen von Al-Farabis Büchern und Ideen führten zu einem tiefgreifenden Wandel im nachfolgenden wissenschaftlichen und religiösen Umfeld. Dieser gewaltige Einfluss rechtfertigt seinen Titel als „Philosoph der Muslime“.
Er leistete einen entscheidenden Beitrag zur Verankerung der Philosophie in der islamischen Welt und demonstrierte dabei eine überzeugende Kompatibilität zwischen strengem rationalem Diskurs und islamischem Denken.
Seine Synthese war so meisterhaft, dass Philosophie und Logik zu integralen Bestandteilen der fortgeschrittenen religiösen Bildung wurden und es bis heute geblieben sind.
Obwohl andere Gelehrte von vergleichbarem Format auftraten, konnte keiner den tiefgreifenden und grundlegenden Einfluss wiederholen, den Al-Farabi auf die Entwicklung der islamischen Philosophie und Logik ausübte – ein Beweis für seine einzigartige Synthese aus Gelehrsamkeit, Originalität und historischem Gespür.
Die nachhaltige Wirkung von Al-Farabis Büchern kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sein bahnbrechendes Werk „Die Meinungen der Bewohner der tugendhaften Stadt“ lieferte einen Entwurf für eine ideale Regierungsführung, der das politische Denken über Jahrhunderte prägte.
Durch die Versöhnung der griechischen Philosophie mit der islamischen Theologie in Texten wie „Die Harmonisierung der beiden Weisen“ sicherte er der rationalen Forschung einen festen Platz innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit.
Seine bahnbrechende Klassifizierung der Wissenschaften in „Die Aufzählung der Wissenschaften“ ordnete das menschliche Wissen systematisch, während seine revolutionären Verfeinerungen der aristotelischen Logik das Fundament schufen, auf dem spätere Giganten wie Avicenna aufbauen sollten.
Schriften zur Musik
Kitāb Iḥṣāʾ al-īqāʿāt („Buch der Klassifikation der Rhythmen“)
Übersetzung: E. Neubauer: Die Theorie vom Īqā, I: Übersetzung des Kitāb al-īqā‘āt von Abū Nasr al-Fārābī’. In: Oriens. Band 34, 1994, S. 103–173.
Kitāb fi ’l-īqāʿāt („Buch über Rhythme“n)
Übersetzung: E. Neubauer: Die Theorie vom Īqā, I: Übersetzung des Kitāb al-īqā‘āt von Abū Nasr al-Fārābī’. In: Oriens. Band 21–22, 1968–1969, S. 196–232.
Kitāb Iḥṣāʾ al-ʿulūm („Buch über die Einteilung der Wissenschaften“)
Kitāb al-Mūsīqā al-kabīr („Das große Buch der Musik“; كتاب الموسيقى الكبير)
Hrsg.: G. A. M. Khashaba, Kairo 1967
Übersetzung: R. d’Erlanger: La musique arabe. Band 1, Paris 1930, S. 1–306, und Band 2, ebenda 1935, S. 1–101.
Sein Kitāb al-Mūsīqā al-kabīr (Großes Buch der Musik) gilt als umfassendste und grundlegende Schrift der „irano-arabo-türkischen“ Musiktheorie und Musiksystematik. In seinen Schriften zur Musik verband er detaillierte Kenntnisse als ausübender, dem Sufismus nahestehenderMusiker und sachliche Präzision als Naturwissenschaftler mit der Logik der Philosophie. Zu von ihm beschriebenen Musikinstrumenten gehören unter anderem das zitherähnliche Saiteninstrument šāh-rūd sowie die Langhalslauten Tanbur (ṭunbūr al-baghdādī und ṭunbūr al-chorassānī), womit er mittels Zeichnungen charakteristische Merkmale von Tonarten, Modi und Intervallen beschreibt. Zentral war für al-Fārābī die Kurzhalslaute ʿūd. Von al-Fārābī selbst wird berichtet, dass er oft bei feierlichen Veranstaltungen diese Laute gespielt habe. Es existieren hierzu einige Anekdoten, die allerdings schwer belegbar sind.
Al-Fārābī begann seine bedeutendste musiktheoretische Abhandlung, das Kitāb al-mūsīqī al-kabīr, aus dem Anlass, dass die überlieferten griechischen Werke seiner Meinung nach von geringerer Qualität waren. Dies führte er auf fehlerhafte Übersetzungen zurück. Ebenso fand er bei den arabischen Musiktheoretikern Ansichten, die entweder auf Verhältnisse der arabischen Musik nicht anwendbar waren oder theoretischen Hintergrund vermissen ließen.So hatte z. B. al-Kindī griechisches Theoriegut auf die arabische Musik übertragen. Al-Kindī selbst fehlten aber praktische Kenntnisse der Musik, um die mangelnde Anwendbarkeit griechischer Musiktheorie auf den vorderen Orient feststellen zu können. Er übernahm einen Großteil griechischen Vokabulars aus einem großen Bereich wissenschaftlicher Disziplinen, grenzte aber die griechische Musiktheorie in bestimmten Punkten von der Musik des Orients ab.
Al-Fārābī grenzt die philosophische Theorie der Musik von der Akustik ab. Er gliedert das Handwerk der Musik in 3 Künste. Die Kunst (fann) Sawa,die erste dieser Künste, ist die Kenntnis der Theorie wie der Akustik, der Intervallslehre, von Melodie und Rhythmus. Die Griechen hatten sich seiner Meinung nach nur auf diese Kunst beschränkt. Die zweite Kunst ist nach al-Fārābī die Kenntnis der Instrumente und das Hervorbringen von Tönen auf denselben, also das Erlernen des Spielens eines Instruments als Verbindung von Theorie und Praxis. Al-Fārābī nimmt hierbei besonderen Bezug auf Kurzhals- und Langhalslauten, Flöte aus Pfahlrohr (nay), arabische Oboe (mizmar) und Harfe (tschang) sowie einige weitere Instrumente. Die dritte Kunst behandelt die Theorie der Komposition an sich. Hierbei geht al-Fārābī auf Konsonanz und Dissonanz ein und behandelt Melodie und Rhythmus. Der die Melodie behandelnde Teil seines Werkes ist für den Laien teils schwer verständlich. Der Rhythmus stellt nach al-Fārābī die Länge und die Ausdehnung der Noten dar. Al-Fārābī verwendet Anleihen bei der Geometrie Euklids zur näheren Beschreibung von Tönen. Analog zur menschlichen Sprache existiert Musik sowohl in rhythmischer, „poetischer“, Form als auch in nicht-rhythmischer Form. Letztere zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen Töne keine feste Länge besitzen.
Al-Farabis Vermächtnis besteht letztlich darin, dass er nicht nur die Weisheit der Antike bewahrte, sondern sie in eine dynamische intellektuelle Tradition verwandelte und so dafür sorgte, dass Philosophie und Logik zu grundlegenden Säulen der Bildung und der wissenschaftlichen Forschung in der islamischen Welt und darüber hinaus wurden.
Bericht von Tohid Mahmoudpour, Aus dem Englischen, ergänzt und bearbeitet irankultur.com
Quellen: https://en.mehrnews.com/news/238992
 IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland