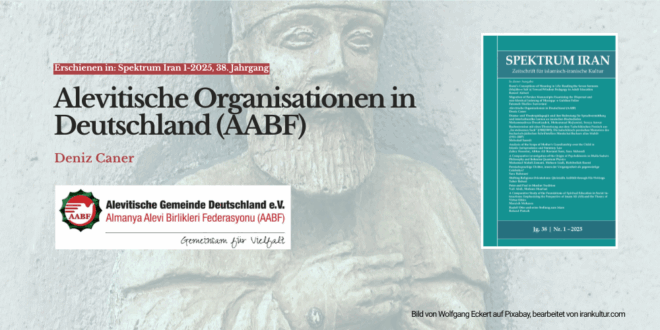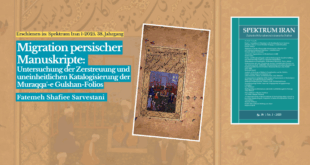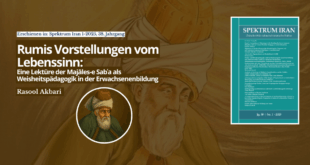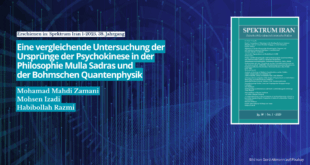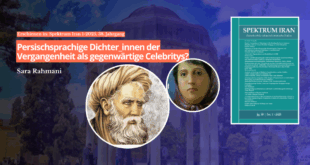Ein entscheidender Schritt für die alevitische Identitätspolitik in Deutschland war die Alevitische Kulturwoche, die im Oktober 1989 von Aleviten an der Universität Hamburg veranstaltet wurde. Nach dieser Veranstaltung wurden rasch anwachsende alevitische Vereine gegründet, und das Alevitentum wurde in Deutschland in der Öffentlichkeit bekannt. Dieser Artikel hat zum Ziel, die alevitischen Organisationen in Deutschland vorzustellen. Insbesondere soll es dabei um die Föderation der Aleviten-Gemeinden in Deutschland e.V. (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, abgekürzt AABF) gehen. Die circa hundert Mitgliedsorganisationen der AABF nehmen beständig an Bedeutung zu. Die Aktivitäten der AABF sind vielfältig; es gibt zahlreiche Veranstaltungen, öffentliche Reden, Erklärungen und die Zeitschrift „Alevilerin Sesi“ (Stimme der Aleviten). Unser Augenmerk gilt in dieser Untersuchung den Zielen und Aktivitäten der AABF, die sie zum Nutzen der Aleviten in Deutschland verfolgt. Ziel ist es, folgende Fragen zu beantworten: Wann und warum wurde die AABF gegründet, und welche Bedeutung hat sie für die Aleviten in Deutschland? Mit welchen Aktivitäten hat sie sich bis heute beschäftigt?
- Problemstellung und Vorgehensweise
Ein entscheidender Schritt für die alevitische Identitätspolitik in Deutschland war die Alevitische Kulturwoche, die im Oktober 1989 von Aleviten an der Universität Hamburg veranstaltet wurde. Nach dieser Veranstaltung wurden rasch anwachsende alevitische Vereine gegründet, und das Alevitentum wurde in Deutschland in der Öffentlichkeit bekannt. „Die anatolischen Aleviten (15.-21. Jh.)“ hat zum Ziel, die alevitischen Organisationen in Deutschland vorzustellen. Insbesondere soll es dabei um die Föderation der Aleviten-Gemeinden in Deutschland e.V. (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, abgekürzt AABF) gehen. Die circa hundert Mitgliedsorganisationen der AABF nehmen beständig an Bedeutung zu. Die Aktivitäten der AABF sind vielfältig, es gibt zahlreiche Veranstaltungen, öffentliche Reden, Erklärungen und die Zeitschrift „Alevilerin Sesi“ (Stimme der Aleviten). Unser Augenmerk gilt in dieser Untersuchung den Zielen und Aktivitäten der AABF, die sie zum Nutzen der Aleviten in Deutschland verfolgt.
Ziel ist es, folgende Fragen zu beantworten: Wann und warum wurde die AABF gegründet, und welche Bedeutung hat sie für die Aleviten in Deutschland? Mit welchen Aktivitäten hat sie sich bis heute beschäftigt?
In diesem Artikel sollen zunächst kurz die alevitischen Glauben und Hadschi Bektasch Veli (13. Jh.), der eine zentrale spirituelle Figur im Alevitentum ist, kurz erwähnt. Anschließend räumliche Verteilung und Stellung der Aleviten in Deutschland und in der Türkei angesprochen werden, wobei zu verdeutlichen versucht wird, wie AABF sich mit ihren Zielen und Projekten, die von besonderer Bedeutung für die alevitischen Migranten in Deutschland sind, beschäftigt. Darüber hinaus nehme ich auch Bezug auf den Religionsunterricht in Deutschland. In der Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse zusammengefasst und der Blick auf künftige Fragestellungen gelenkt.
- Die Aleviten
2-1. Grundlagen des alevitischen Glaubens
Der Begriff „Alevite“ (Alevi) wie er heute verwendet wird, ist ein Überbegriff für in ihren religiösen Vorstellungen und ihrem Kultus weitgehend übereinstimmende, tribal organisierte, in ihrer Mehrheit türkischsprachige, aber zu ca. einem Drittel auch kurdischsprachige, anatolische Glaubens- und Sozialgemeinschaften. Diese alevitischen Gemeinschaften definierten sich in ihrem traditionellen Umfeld über jeweils eigene Stammesidentitäten. z.B.; Tahtaci. Cepni, Abdal, Avşar, Kocgiri.“ (Dressler, 2002, S. 171-172). Das traditionelle Alevitentum konstituierte sich als nach außen abgeschlossene Sozial- und Ritualgemeinschaft, wie idealtypisch von im Zitat genannten Ausdrücken beschrieben.
Die Aleviten glauben an eine heilige Kraft des Schöpfers, die an die Menschen, vor allem durch den Propheten Mohammad und seinen Schwiegersohn Ali, sowie durch dessen Nachkommen, bis heute übertragen wird. „Nach diesem Glauben wird der Mensch als (yansıma) Widerspiegelung Gottes betrachtet. Mohammad und Ali sind die Vorbilder für diese Widerspiegelung, indem sie einerseits Gott reflektieren und Gott ähnlich sind und andererseits Gott im Menschen reflektieren und menschliche Eigenschaften haben. (Kaplan, 2004, S. 39).
Die Aleviten drücken ihren Glauben zusammenfassend in folgendem Glaubensbekenntnis aus: „Allah tan başka Ilah yoktur, ve Muhammed bir peygamberdir, ve Ali onun arkadaşıdır“ (Es gibt keinen anderen Gott außer Allah, Mohammad ist ein Prophet und Ali sein Freund). Sie verwenden dieses Glaubensbekenntnis auch in einer Kurzform: „Ya Allah, ya Mohammad, ya Ali“ (O Allah, O Mohammad, O Ali). Für die Aleviten besteht eine Identität, d.h. eine geistige Gleichartigkeit zwischen Gott, Mohammad und Ali. Dies zeigt sich neben dem Glaubensbekenntnis z.B. in einem Kultspruch: „Allah- Mohammad- Ali“ oder „Hak-Mohammad-Ali“ (Kaplan, 2004, S. 39).
Nach alevitischer Auffassung erscheint Gott den Menschen als die Wahrheit in verschiedenen Formen. Aleviten formulieren folgendermaßen: „Nur diejenigen können diese Wahrheit sehen, die den Vervollkommnungsprozess durchmachen“. Die Auffassung, dass Mohammad und Ali einen Teil der Wahrheit bilden, wird im oben genannten Glaubensbekenntnis formuliert. Mohammad und Ali sind vollkommen und bleiben vollkommen. „Sie zeigten den Menschen ihre Vollkommenheit in ihrer Lebensweise. Auch ihre Nachkommen (die zwölf Imame) sind von dem gleichen Licht erleuchtet. Deshalb ehren die Aleviten die 12 Imame als Symbole für diesen Glauben. Imam bedeutet hier Ehrenbeziehung für Nachkommen des Heiligen Ali und seiner Frau Fatima, der Prophetentochter. Aus jeder Generation wurde der wichtigste Sohn zum Imam ernannt. Ihm allein gestehen Aleviten und Schiiten das Recht zu, die Gläubigen geistig zu führen“ (Kaplan, 2004, S. 39).
Der Glaube an das Alevitentum ist durch die Ideen wichtiger religiöser Persönlichkeiten wie Hodscha Ahmed Yesevî, Abu’l Vefâ, Kutbu’d-Dîn Haydar, Hadschi Bektasch Veli, Ahi Evran, Taptuk Emre, Seyyid Nesîmî, Pir Sultan Abdal und Abdal Musa strukturiert, die wichtige Spuren im Prozess der Islamisierung Anatoliens hinterlassen haben. Hier ist besonders von großer Bedeutung, Hadschi Bektasch Veli zu erwähnen, um den alevitischen Glauben tief zu greifen. Denn Hadschi Bektasch Veli wird von allen Aleviten als Heiliger und Gründer des anatolischen Alevitentums verehrt.
2.2 Hadschi Bektasch Veli
Hadschi Bektasch Seyyid Muhammed Huseynî al-Horasanî al-Nischâburî (gest. 1271) der für die Aleviten einen wichtigen Platz einnimmt wurde im Dorf Fushenjan in der Stadt Nischâbûr in der Region Khorasan geboren und entstammte einer wohlhabenden Familie. Nach seiner Ausbildung in der Madrasa in Nischâbur wandte sich Hadschi Bektasch Veli in den folgenden Jahren dem Sufismus zu (Avşar, 2017, S. 20-21). Hadschi Bektas Veli verbrachte die ersten 25 Jahre seines Lebens in Nischâbur, wo er von namhaften Wissenschaftlern Turkestans unter der Leitung von Lokman Perende Philosophie, Physik, Literatur und andere Wissenschaften lernte. Hadschi Bektasch Veli, der an Rationalismus und Wissenschaft glaubte, wurde in der Hodscha Ahmed Yesevî-Loge in Khorasan ausgebildet, wo viele Wissenschaftler aufwuchsen und erwarb ein umfassendes Wissen und eine breite Weltanschauung. Er vertiefte sein Wissen durch ausgedehnte Reisen nach Turkestan, Iran, Bagdad, Kerbela, Mekka und Syrien.
Hadschi Bektasch ist vor der mongolischen Invasion nach Westen in das Reich der Seldschuken, welches sich zu einer Fluchtstätte für iranische Gelehrten und Heilige entwickelt hatte, geflohen. Hadschi Bektasch Veli ließ sich in Karayol nieder, die 40 km von Kırşehir in Anatolien entfernt liegt. Er ist von Lokman Parende, der 6. Scheich (Postneschen) von Ahmed Yesevî war, herangebildet.
Weiter zum Artikel:
PDF: https://www.spektrumiran.com/article_223358_60e1d92e7a80ee101ae36c385d72941a.pdf
Autorin: Deniz Caner, Universität Istanbul, Türkiye
https://www.spektrumiran.com/article_223358.html
https://doi.org/10.22034/spektrum.2025.504990.1022
Quelle: Spektrum Iran
 IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland