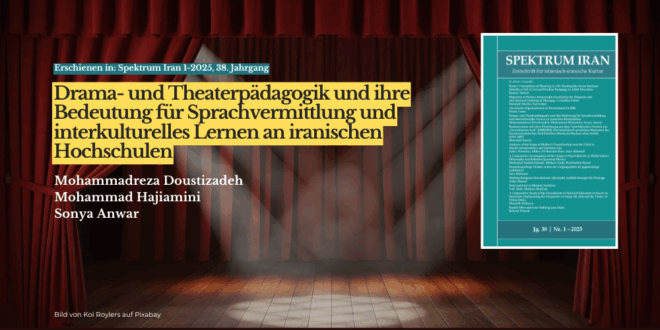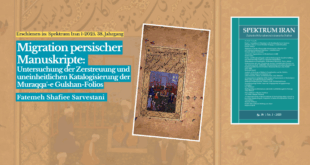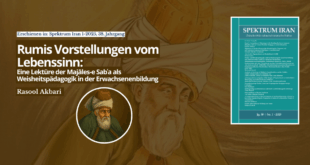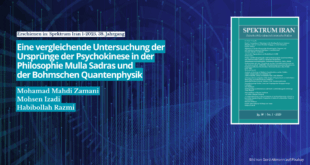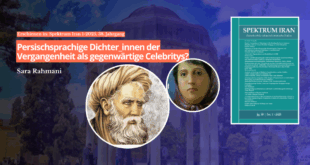Mohammadreza Doustizadeh, Mohammad Hajiamini, Sonya Anwar (Erschienen in Spektrum Iran 1-2025, Jahrgang 38)
Diese qualitative Fallstudie untersucht die Rolle der Drama- und Theaterpädagogik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) an iranischen Hochschulen im Zeitraum 1403–1404 (2024–2025). Ziel der Studie ist es, zu analysieren, inwiefern dramapädagogische Methoden den Lernprozess von Studierenden erleichtern, insbesondere im Hinblick auf den Abbau von Sprechhemmungen, das Erlernen neuer Vokabeln und grammatikalischer Strukturen sowie die Förderung interkultureller Kompetenzen. Ausgangspunkt ist die Frage, ob und wie Theaterarbeit zur Überwindung von Scham und Sprachangst beitragen und Studierende – vor allem in den Anfangssemestern – zur aktiven Teilnahme und Ausdrucksfähigkeit im Unterricht motivieren kann. Zudem wird untersucht, ob die Arbeit mit dramatischen Texten das kulturelle Verständnis stärkt und die Motivation zur Textarbeit erhöht. Die Datenerhebung erfolgte durch Gruppendiskussionen sowie offene Fragebögen mit Studierenden der Germanistik an der Universität Teheran. Alle Aussagen wurden transkribiert und mithilfe der Software MAXQDA qualitativ ausgewertet. Zur Sicherung der Vertrauenswürdigkeit der Daten wurden die Ergebnisse durch Triangulation der Methoden (Diskussion + Fragebogen), Teilnehmerfeedback sowie konsistente Kategorienbildung überprüft. Die Studie zeigt auf, dass dramapädagogische Ansätze nicht nur die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das interkulturelle Lernen unterstützen, sondern auch zur persönlichen Entwicklung der Lernenden beitragen können. Sie ruft Lehrende dazu auf, das Potenzial dieser Methode systematisch zu nutzen und in den DaF-Unterricht zu integrieren.
- Einleitung
Das Interesse am Theaterspielen mit Fremdsprachenlernenden entstand in den 1980er Jahren – nicht etwa in Deutschland, sondern in der Nähe von Paris – während eines Treffens französischer Deutschlehrkräfte. Der Fokus verlagerte sich damals vom erklärenden zum improvisierenden, vom erzählenden zum handelnden und vom abwartenden zum aktiven Lernen (vgl. Isabelle-Bernard, 2010; Joannie-Dubois & Ophélie-Tremblay, 2015; Mathilde-Dallier, 2014). Theaterarbeit wurde als alternative Methode im Fremdsprachenunterricht erkannt, insbesondere dann, wenn Sprachreisen oder ein Aufenthalt im Zielsprachenland nicht möglich sind. Der Fremdsprachenunterricht bleibt in vielen Ländern – so auch im Iran – traditionell und lehrkraftzentriert. Innovative Ansätze wie die Dramapädagogik, welche spielerisches Lernen, kulturellen Austausch und persönliche Entwicklung integriert, sind bisher kaum etabliert.
In der Fachliteratur wird dabei zwischen „Dramapädagogik“ und „Theaterpädagogik“ unterschieden: Während die Dramapädagogik meist auf prozessorientiertes, kreatives Spiel ohne Aufführungsdruck zielt und stark im Bildungsbereich verankert ist, betont die Theaterpädagogik stärker die Inszenierung, Bühnenarbeit und produktionsorientiertes Lernen (vgl. Schewe, 1993; Even, 2008; Hentschel, 2010). Diese begriffliche Differenzierung ist für die folgende Studie relevant, da sie unterschiedliche didaktische Zielsetzungen und methodische Zugänge impliziert.
Dabei haben Studien gezeigt, dass Theaterarbeit nicht nur die mündliche Ausdrucksfähigkeit verbessert, sondern auch zur Überwindung von Sprachangst beiträgt, die Motivation steigert und interkulturelles Lernen fördert (vgl. Moraitis, 1949; Müller, 2019). Gerade im frühen Stadium des Spracherwerbs kann die kreative und körperliche Arbeit mit dramatischen Texten zu einem lebendigen und nachhaltig wirkenden Lernprozess führen. Diese Studie geht der Frage nach, wie dramapädagogische Methoden den Lernprozess im Fremdsprachenunterricht – insbesondere im Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) – erleichtern und bereichern können.
Die zentrale Fragestellung lautet:
- Wie können Theater und dramapädagogische Ansätze das Lernen einer Fremdsprache erleichtern und fördern?
Daraus ergeben sich folgende forschungsleitende Teilfragen:
- Können dramapädagogische Methoden dazu beitragen, Scham, Angst und Hemmungen beim Sprechen – insbesondere bei Anfängern – zu reduzieren?
- Erleichtert das Rollenspiel, das Üben von Szenen und das performative Arbeiten das Einprägen neuer Vokabeln und grammatischer Strukturen?
- Fördern dramatische Texte das kulturelle Verständnis sowie die Offenheit für Unterschiede zwischen der Muttersprache und der Zielsprache?
- Sind Lernende durch die kreative Arbeit mit Theatertexten stärker zur Textarbeit motiviert als bei traditionellen Unterrichtsformen?
Ziel der Untersuchung ist es, die Perspektiven und Erfahrungen von Studierenden im DaF-Studiengang der Universität Teheran zu analysieren, die aktiv an dramapädagogischen Aktivitäten teilgenommen haben. Der Fokus liegt auf jenen Aspekten des Lernprozesses, die aus Sicht der Lernenden durch theatrale Arbeit erleichtert oder bereichert wurden. Die Studie folgt einem qualitativen Forschungsdesign mit Fallstudienansatz. Die Datenerhebung erfolgte durch zwei Methoden:
- Focus Group Discussion (FGD): Hier nahmen DaF-Studierende (meist aus dem 1. bis 6. Semester) teil. Diskutiert wurden insbesondere drei Schwerpunkte:
- die Überwindung von Sprechhemmungen und Unsicherheit durch Theaterarbeit,
- der Erwerb von Wortschatz und Grammatik durch darstellerische Übungen,
- die Entwicklung einer kulturellen Nähe zur deutschen Sprache durch szenische Lesungen.
- Offener Fragebogen: Dieser wurde jenen Studierenden zur Verfügung gestellt, die nicht an der Gruppendiskussion teilnehmen konnten. Die Fragen waren offen formuliert, um persönliche Erfahrungen möglichst frei zu erfassen.
Alle erhobenen Daten wurden transkribiert und mit der Software MAXQDA thematisch analysiert. Zentrale Themen und wiederkehrende Muster wurden qualitativ codiert und ausgewertet. Der Artikel gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst erfolgt eine Begriffsklärung und theoretische Verortung der Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. Anschließend werden dramapädagogische Methoden im Kontext der DaF- und Neurodidaktik diskutiert. Im nächsten Abschnitt werden ausgewählte Forschungsergebnisse aus der qualitativen Untersuchung dargestellt. Abschließend werden Potenziale und Herausforderungen der Theaterpädagogik in iranischen Hochschulen aus lokaler Perspektive reflektiert.
- Theoretischer Rahmen und Begriffsklärung
Theaterpädagogik stellt eine interdisziplinäre Bildungsform dar, die künstlerisch-darstellende Mittel nutzt, um Lernprozesse ganzheitlich zu fördern. Sie verbindet theatrale Methoden mit pädagogischen Zielsetzungen und fokussiert dabei auf kreative Ausdrucksformen, soziale Interaktion sowie persönliche Entwicklung. In theoretischer Hinsicht stützt sich die Theaterpädagogik auf konstruktivistische Lerntheorien, welche das aktive, erfahrungsbasierte und subjektzentrierte Lernen betonen (vgl. Schlesier & Raufelder, 2024). Lernende erschließen sich Wissen und Kompetenzen durch Verkörperung, Perspektivwechsel und ästhetisches Experimentieren – ein Ansatz, der unter anderem in Frimbergers (2016) Analyse von Brechts Theaterpädagogik für interkulturelle Bildung durch das Konzept des embodied learning verdeutlicht wird. Hierbei steht nicht nur der kognitive Wissenserwerb im Zentrum, sondern auch emotionale und körperliche Dimensionen, die durch den Einsatz von Stimme, Bewegung und Mimik angesprochen werden. Neuere Forschungen beleuchten die vielfältigen Schnittmengen zwischen Drama Education, Theaterpädagogik und therapeutischen Anwendungen. Holmwood (2022) untersucht die Verbindung zwischen westlicher Dramapädagogik und der chinesischen „Integral Drama Based Pedagogy“ und hebt deren Beitrag zur emotionalen und integrativen Bildung hervor. Bololia et al. (2022) analysieren in einem systematischen Review die Wirksamkeit von Dramatherapie bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen und berichten über positive Effekte auf deren Verhaltensweisen, Ausdrucksvermögen und soziale Fähigkeiten. Auch Schnyder et al. (2021) betonen in ihrer Untersuchung zur Rolle von Theaterkunst in der frühkindlichen Resilienzförderung die entwicklungsfördernden Potenziale dieser Methoden. Während diese Studien vor allem angewandte Aspekte fokussieren, bietet Höyng (2021) mit seiner Analyse zu Entwicklungen der österreichischen Dramatik seit den 1960er Jahren einen historischen Bezugsrahmen zur Veränderung performativer Praktiken. Zusammen zeigen diese Studien die Breite und Aktualität der Theaterarbeit im Bildungs- und Therapiekontext – und zugleich den Bedarf nach weiterführender empirischer Forschung in verschiedenen Anwendungsfeldern. Zentrale Ziele der Theaterpädagogik umfassen die Förderung von Selbstwirksamkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität. Durch Gruppenarbeit und Rollenspiele werden soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konfliktlösung und Perspektivenübernahme ausgebildet, wodurch auch interkulturelle und intergenerationelle Verständigungsprozesse begünstigt werden. Diese pädagogische Ausrichtung macht die Theaterpädagogik zu einer wichtigen Komponente ganzheitlicher Bildungsprozesse, insbesondere im Kontext des Spracherwerbs (vgl. Koerner, 2024). Die Integration von Theatermethoden in den Fremdsprachenunterricht – insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) – ermöglicht ein handlungsorientiertes und erfahrungsbasiertes Lernen, das durch emotionale Beteiligung und kreative Aneignung sprachlicher Mittel nachhaltig wirksam wird (vgl. Eriksen et al., 2015; Pottmann, 2020). Hierbei spielen auch zugängliche Sprachkonzepte wie „Leichte Sprache“ und „Einfache Sprache“ eine Rolle, um sprachliche Barrieren im Unterricht abzubauen (ebd.). Im Kontext der Fremdsprachendidaktik hat insbesondere Manfred Schewe mit seiner Arbeit zur Dramapädagogik und dem Rückblick auf dramatische Lehransätze seit dem 19. Jahrhundert wegweisende Impulse geliefert. Seit den 1970er-Jahren hat sich eine intensive Auseinandersetzung mit der Verbindung von Theater und Sprachvermittlung entwickelt, insbesondere durch Werke wie „Szenisches Spiel und freies Sprechen im Fremdsprachenunterricht“ von Maley und Duff (1985), die szenisches Spiel als sprachdidaktisches Werkzeug systematisch erschließen. In der DaF-Didaktik werden mittlerweile nicht nur die literarisch-interkulturellen Potenziale, sondern auch die performativen, produktiven und kommunikativen Dimensionen der Theaterpädagogik berücksichtigt. Die Gründung des Deutschen Archivs für Theaterpädagogik an der Stiftung FH Osnabrück im Jahr 2007 verdeutlicht die institutionelle Verankerung dieses Ansatzes in Forschung und Lehre. Im praktischen Hochschulkontext zeigt sich zudem, dass die terminologische Unterscheidung zwischen Dramapädagogik und Theaterpädagogik von Studierenden (und teilweise auch Lehrenden) nicht immer konsequent vorgenommen wird. Die beiden Begriffe werden im Alltag oft synonym verwendet, da sie in der Lehrpraxis meist miteinander verflochten sind: Das Lesen und Analysieren dramatischer Texte (dramapädagogischer Zugang) geht häufig in szenisches Spiel oder theatrale Darstellung (theaterpädagogischer Zugang) über. Daher berücksichtigt die vorliegende Untersuchung bewusst beide Perspektiven und versteht ihre Kombination als integrierten Bestandteil des Fremdsprachenlernens. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Kontextualisierung theaterpädagogischer Ansätze für den iranischen Hochschulraum. Die sprachliche und kulturelle Ausgangssituation unterscheidet sich grundlegend von europäischen Verhältnissen. Die Suche nach sprachlicher Identität, Mehrsprachigkeit und ein oftmals divergierendes Selbstverständnis der Muttersprache stellen besondere Herausforderungen, aber auch Chancen für kreative sprachdidaktische Modelle dar. Gerade hier bietet die Theaterpädagogik ein enormes Potenzial, um Sprachunterricht handlungsorientiert und inklusiv zu gestalten, vorausgesetzt, es erfolgt eine abgestimmte pädagogische Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene. Die Universität Teheran als Zentrum der DaF-Ausbildung kann dabei als Pilotort für innovative Methodenentwicklung dienen. Ein weiterer theoretischer Rahmen zur Fundierung theaterpädagogischer Methoden ist die Neurodidaktik. Diese verbindet neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit didaktischen Prinzipien und legt besonderes Gewicht auf die Rolle von Bewegung, Begeisterung und emotionaler Aktivierung im Lernprozess. Theaterpädagogik als bewegungsorientierte, ganzheitliche Methode kann hier gewinnbringend eingesetzt werden, da sie lernförderliche Bedingungen schafft und das Speichern von Inhalten sowie soziale Kohärenz unterstützt (vgl. F., A. & Kersten, V. V. A. S., 2023). Trotz berechtigter Kritik, etwa von Paulus, dass viele neurodidaktische Erkenntnisse lediglich altbekannte pädagogische Prinzipien neu verpacken, besteht Einigkeit darüber, dass die pädagogische Praxis von affektiven, körperlich-sinnlichen und multimodalen Lernformaten profitiert – ein Anspruch, den theaterpädagogische Methoden in hohem Maße erfüllen. Insgesamt zeigt sich, dass Theaterpädagogik ein alternatives, interaktives und kooperatives Lernmodell darstellt, das nicht nur die Sprachkompetenz, sondern auch emotionale Intelligenz, kulturelle Sensibilität und soziale Handlungskompetenz der Lernenden fördert. Durch die Verbindung von kognitiven, emotionalen und performativen Dimensionen stärkt sie nicht nur die mündliche Kommunikation und das Ausdrucksvermögen, sondern fördert auch die interkulturelle Verständigung – ein Aspekt, der für den DaF-Unterricht in transkulturellen Kontexten von zentraler Bedeutung ist (vgl. Blank, 2024; Norris & Drackert, 2018).
Autoren:
- Mohammadreza Doustizadeh: Assistenzprofessorin, Fakultät für Fremdsprachen und Literaturen, Universität Teheran
- Mohammad Hajiamini: Doktorand für Deutsch als Fremdsprache und Literatur an der Universität Teheran
- Sonya Anwar: Doktorandin für Deutsch als Fremdsprache und Literatur an der Universität Teheran
Weiter zum Artikel:
PDF: https://www.spektrumiran.com/article_223356_18dcabb97e76a19483b0262be33d3fd3.pdf
https://www.spektrumiran.com/article_223356.html
Quelle: Spektrum Iran | www.spektrumiran.com
Bild von Koi Roylers auf Pixabay
 IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland