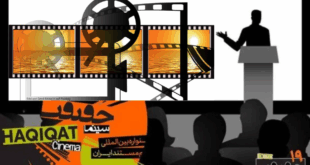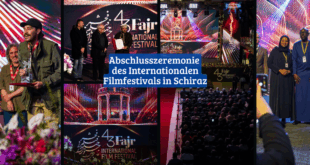Der Film „Bedoone Gharare Ghabli (بدون قرار قبلی) handelt von einer Frau namens Yasemen, die aufgrund des Todes ihres Vaters nach vielen Jahren aus Deutschland in den Iran zurückkehrte. Ihr Sohn ist Autist und das macht das Reisen schwer. Yasemen kennt ihren Vater nicht und das Vermächtnis, das ihr Vater ihr hinterlassen hat, überrascht sie. Während dieser Reise begegnet sie Menschen und ihr kurzer Aufenthalt in der Heimatstadt ihres Vaters und Begegnungen mit denen, die ihren Vater kennen, führen sie zu einem neuen Verständnis des Menschen und des Todeskonzepts.
- Filmname: Bedoone Gharare Ghabli (فیلم بدون قرار قبلی آپارات)
Auf Deutsch: Ohne vorherigen Termin - Name des Films auf Englisch: No Prior Appointment
Regie: Shoaybi Behrouz - Drehbuchautoren: Farhad Tawhidi, Mohammad Tarab Beigi
- Hauptdarsteller: Pegah Ahangarani, Mostafa Zamani, Elham Korda, Sabre Abar, Reza Saberi
- Produktionsjahr: 2022
- Auszeichnungen: Crystal Simorgh-Gewinner für beste Regie, Drehbuch, Tonaufnahme, Synchronisation und Kamera sowie bester nationaler Film beim 40. Internationalen Filmfestival Fadschr.
- Filmgenre: Familie, religiös, drama
- Hauptthema: Tod und Wahrheitssuche
Geschichte des Films
Yasemen (gespielt von Pegah Ahangarani) ist eine iranische Ärztin, die in Deutschland in der Stadt Berlin lebt. Yasemens Mutter hat sich vor Jahren von ihrem Vater getrennt und sie ist vor dreißig Jahren mit ihrer Mutter aus dem Iran ausgewandert. Sie hat nicht viel gehört über ihren Vater seit Jahren. Der Anwalt von Yasemens Vater (gespielt von Saber Abar) gibt ihr am Telefon die Nachricht vom Tod ihres Vaters und sagt, dass ihr Vater ein Testament hinterlassen hat, wo er schreibt, dass sie ihn beerdigen sollen bis seine einzige Tochter in den Iran kommt. Yasemen entschließt sie sich schließlich, mit ihrem kleinen Sohn Alex, der aufgrund psychischer Probleme und Autismus nicht sprechen kann, für ein paar Tage in den Iran zu reisen und an der Beerdigung ihres Vaters teilzunehmen.
Yasemen nimmt zusammen mit ihrem Stiefbruder, der aus der zweiten Ehe ihres Vaters hervorgegangen ist, an der Beerdigung teil. Ihr Vater war ein Universitätsprofessor, Architekt, Schriftsteller und Mystiker gewesen. Nach der Trauerfeier teilt ihr der Anwalt ihres verstorbenen Vaters mit, dass von dem gesamten väterlichen Erbe inklusive der Lizenzgebühren seiner Bücher, ihr nur ein Grab im Hofe vom Schrein des Imam Reza (a) vererbt worden sei. Yasemen, die sich ungerecht behandelt fühlt, will nach Deutschland zurückkehren.
Doch auf Drängen des Anwalts beschließt sie, nach Maschhad zu reisen, um das Grab abzugeben und zu verkaufen, was offenbar einen hohen finanziellen Wert hat. In Maschhad geht sie zum Haus ihrer Tante (gespielt von Elham Korda) und trifft auf Anraten des Anwalts einen ehemaligen Studenten ihres Vaters, dem Ingenieur Maschayech (gespielt von Mostafa Zamani) und lernt ihn kennen.
Durch das Kennenlernen von Ingenieur Maschayech lernt Yasemen die Persönlichkeit und mystische Natur ihres Vaters kennen und sieht, dass ihr Vater sie in all den Jahren nicht nur nicht vergessen hat, sondern sie in Form einer Unbekannten Person im virtuellen Raum in die iranische und islamische Mystik eingeführt hat.
Aufgrund der geistigen und spirituellen Fähigkeiten und Talente, die er in seiner Tochter Yasemen sah, hinterließ er ihr dieses spirituelle Erbe. Schließlich entwickelt sich eine engere Freundschaft zwischen Yasemen, die seit einiger Zeit von ihrem Mann getrennt ist, und dem Ingenieur Maschayech. Ihre Interessen und ihre Gedanken über die Vergangenheit und über die Persönlichkeit ihres Vaters, über den Iran und der iranischen Kultur verändern sich.
Filmanalyse
Der Film Ohne vorherige Vereinbarung kann als ein Film betrachtet werden, der das iranisch-islamische Gedankengut gekonnt, elegant und zärtlich darstellt. Behrouz Shoaibi als Regisseur scheint aufgrund seiner Erfahrung und seiner bisherigen Filme im islamisch-mystischen Genre in diesem Film gereift zu sein. Mit der richtigen Anleitung der Schauspieler konnte er von den nostalgischen Elementen der Bühne wie Fliesen und islamische Architektur profitieren und hat die mystischen und islamischen Konzepte des wunderschönen Drehbuches von Farhad Tawhidi und Mohammad Tarabbighi korrekt dargestellt.
Die Geschichte dieses faszinierenden Films, der eine freie Adaption einer Kurzgeschichte von Mustafa Mastour ist, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Aber vielleicht konzentriert sich die Haupterzählung dieses Films auf die Lebensgeschichte eines Vaters und einer Tochter, die eine Beziehung aus zwei unterschiedlichen und scheinbar fremden kulturellen Hintergründen aufbauen, einem Vater aus dem Osten und einer westlichen Tochter.
Dramatische und mystische Beziehungen, die nach dem Tod des Vaters und mit der Entdeckung von Zeichen und Erzählungen aus dem Leben des Vaters entstanden. Das Erbe was Yasemen erhielt ist ein Grab. Ein Grab am heiligsten Ort des Iran, dem Schrein des 8. schiitischen Imams. Auf den ersten Blick erscheint dieses Erbe der im Westen aufgewachsenen Yasemen sinnlos und absurd.
Sie, hat als eine Kardiologin berufsbedingt den Tod vieler Menschen gesehen, doch für Sie haben die Begriffe Leben und Tod eine andere Bedeutung, eine eher materielle Bedeutung. Doch mit ihrer Reise in den Iran erfährt sie in Gestalt einer Reisenden mit östlichen Wurzeln mehr über die mystisch-islamische Vorstellung von Tod und dem Leben danach.
Auf der anderen Seite spielt Yasemens Sohn Alex, der seit einiger Zeit nicht mehr sprechen kann und seine emotionale und einsame Leere ständig mit Computerspielen füllte, spielte während seines Aufenthalts im Haus der Tante in Maschhad mit ihren Kindern und ist in der warmen Familie glücklich. Unter dem positiven Einfluss der Familie gewinnt er allmählich seine Sprachkraft zurück.
Auf der anderen Seite trauert Ingenieur Maschayech, der als Student die engste Person von Yasmans Vater vorgestellt wurde und im Moment seines Todes an seinem Bett war, nicht um seinen Meister. Da er ein so tiefes Verständnis des Todesbegriffs erlangt hat, betrachtet er den Tod als ein neues Leben und einen Weg zur Unsterblichkeit.
Diese schöne und poetische Interpretation des Todes findet sich in vielen islamischen und mystischen Überlieferungen und Dichtern und Denkern des islamischen Iran. Alles in allem kann der Film als kulturelles und nationales Symbol des islamischen Kinos und der Kunst vorgestellt werden, das mit einer poetischen und spirituellen Eleganz in die Gedanken und Seelen seines Publikums eindringt und die Menschen unserer Erde einlädt, über die reine und tiefe Iranisch-islamische Kultur nachzudenken. Außerdem weckt es für Iraner die schönen Erinnerungen an den Iran und schafft mit seiner poetischen Erzählung eine warme und intime Atmosphäre zum Studieren und Zurückkehren zur authentischen und alten iranisch-islamischen Kultur.
https://www.imdb.com/title/tt14443682
https://viff.org/whats-on/no-prior-appointment
https://thecinematheque.ca/films/2022/no-prior-appointment
https://mubi.com/films/no-prior-appointment
https://www.avclub.com/film/reviews/no-prior-appointment-2022
https://cinando.com/en/Film/no_prior_appointment_418585/Detail
https://www.iranianmoviebox.com/movie/bedoone-gharare-ghabli-movie/
 IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Persisch | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland